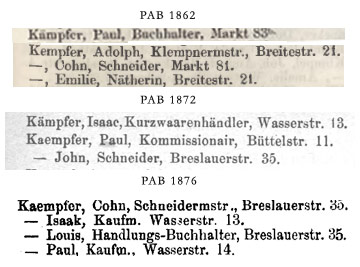Die Stadt Poznań hatte die gute Idee, über Internet alte „Adreßbücher“
zur Verfügung zu stellen
(1), denen ich einige interessante Informationen entnehmen
konnte, zumal es sich bei dem ab 1872 dort eingetragenen Isaac
Kämpfer
(2) sehr wahrscheinlich um Georgs Vater handelt. Beim Studium dieser
Posener Adressbücher (PAB) bemerkte ich auch die wechselnde Schreibweise
des Nachnamens – Kempfer (PAB 1862), Kämpfer (PAB 1879,
1885), Kaempfer (PAB 1876, 1886ssq.) – und nicht zuletzt die
erstaunliche Verwandlung des Vornamens meines Ururgroßvaters Cohn
in John (PAB 1872), der ich auf einer späteren – im Zuge des
Naziterrors gefälschten – Urkunde noch einmal begegnen sollte.
Ich möchte nun die Erkenntnisse zusammenfassen, die ich durch das
Studium dieser wichtigen Dokumente gewinnen konnte: Die von der Stadt
Poznań digitalisierten und im Internet abrufbaren Adressbücher umfassen
die Zeit von 1835 bis 1917, wobei bis zum Jahrgang 1872 nur drei
Ausgaben verfügbar sind (1835, 1844, 1862). Vorab jedoch die beiden mir
zu Anfang dieser Recherche bekannten Zweige der Posener Kaempfers, ohne welche die nachstehenden
Ausführungen schwer verständlich wären. Prof. Raymond Kaempfer aus
Jerusalem war so freundlich, mir die ihn betreffende Posener
Familiensequenz mitzuteilen
(3):
Kaempfer, Getreidehändler („Pan Pariscu“), ? – ?
Paul Kaempfer, Kaufmann, 1840 – 1919
Dr. Felix Kaempfer, Rechtsanwalt, 1869 – 1920 (Berlin), 2 Brüder
(Gunther und Otto)
Heinz Kaempfer 1904 – 1986 (Den Haag, Vater von Raymond)
Und hier meine eigene, aus Gerhard Petzolds "Kaempfer-Story"
(GPK) (4) hervorgehende und ebenfalls auf den Raum Posen beschränkte
Sequenz:
A—Adolf Phillip Kaempfer, „Fuhrknecht, später Tuch- und Spezereiwaren“
1744 (Pommern) – 1817
(5).
1779 Übertritt zum Judentum und Heirat in Posen mit Sarah Wendel
(1756–1801)
(6)
B—Jacob Kaempfer, „Tuch- und Seidenhändler“, 1786 (Wreschen
)
(
7) – 184?
1816 – Heirat in Posen mit Henriette Loewe (1787-1841), 1 Sohn:
C.—Cohn (auch „John“) Kaempfer, Schneidermeister, 1820 (Wreschen) – 1902
1846 – Heirat in Wreschen mit Emilie Lachmann (1820 – 1886), 6 Söhne, 1
Tochter
D—
Dr.
David Kaempfer, Physiker und Unternehmer, 1859 – 1940 (Braunschweig,
mein Urgroßvater)
(8)
Und nun zu den Posener Adressbüchern: Dem unvollständigen Register von
1835, in welchem die Bürger der Stadt noch nach Ämtern und Berufen
eingetragen wurden, habe ich bislang keine relevanten Informationen
entnehmen können. Auch die folgende Ausgabe (1844) gibt wenig her. Erst
im dritten der verfügbaren Adressbücher haben wir gleich zwei Treffer:
[1862]
Kämpfer, Paul, Buchhalter, Markt 83b (Raymonds
Urgroßvater)
Kempfer, Cohn, Schneider, Markt 81 (mein Ururgroßvater)
Nach weiteren 10 Jahren Unterbrechung ist die Reihe bis 1917 relativ
vollständig:
[1872]
Kämpfer,
Isaac, Kurzwarenhändler, Wasserstr. 13 (höchstwahrscheinlich Georgs
Vater)
Kaempfer, Paul, Kommissionär, Büttelstr. 11
Kaempfer, John[!], Schneider, Breslauer Str. 35
[1876]
Kaempfer, Isaak, Kaufmann, Wasserstr. 13
Kaempfer, Paul, Kaufmann, Wasserstr. 14
Kaempfer, Cohn, Schneidermeister, Breslauer Str. 35
Kaempfer, Louis, Handlungs-Kaufmann, Breslauer Str. 35
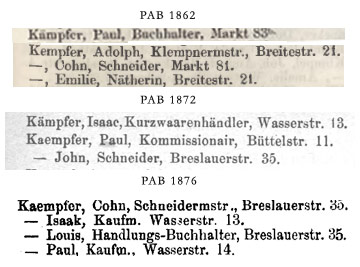
Man sieht hier, dass die Orthographie der Namen und
teilweise auch der Vornamen schwankt. Die schon hervorgehobene
„Cohn-John-Variation“ wird noch zu erörtern sein. Was die Adressen
betrifft, ist zu bemerken, dass die Büttelstraße (Paul, 1872) parallel
zur Wasserstraße (Paul, 1876) verläuft und die dazwischen liegenden
Wohnhäuser Ausgänge nach beiden Seiten haben mussten. Breslauer, Büttel-
und Wasserstraße führen außerdem alle drei zum zentralen Alten Markt, wo
die Kaempfers zeitweise ihre Läden und Geschäfte hatten. In der
Breslauer Straße 35 ist spätestens seit 1876 neben Cohn ein gewisser
Louis als Kaufmann gemeldet, in dem ich einen der 6 Söhne des
Schneidermeisters vermute. Ab 1879 geben die Adressbücher dann auch
Auskunft über die Etagen (Parterre [pt.] bzw. 1.[I.] oder
2. [II.] Stock) und über die private (w.) oder
geschäftliche (GL.) Nutzung der Adresse: Über den „Klempner“
Adolph Kempfer (1862) habe ich keine Informationen. Allerdings könnte
die im gleichen Jahr und unter gleicher Adresse angeführte Näherin Cohns
Frau Emilie geb. Lachmann sein. Dann wäre zu ergründen, warum die
Eheleute unterschiedliche Adressen angeben und Emilie sowie Adolph in
der Breitestr. 21 gemeldet sind. Der Markt 81 könnte das Atelier des
Schneiders sein.
[1879]
Kämpfer, Jacob
(12), Kaufmann, Kurzw., Wasserstr. 13 GL. pt., w. I.
Kämpfer, Paul, Kaufmann, Getreide, Wasserstr. 14 I.
Kämpfer, Jacob, Kaufmann, Breslauer Str. 35 II.
Kämpfer, Cohn, Schneidermeister, Breslauer Str. 35 II.
Kämpfer, Louis, Kaufmann, Leinen u. Wäsche,w. Breslauer Str.
35 II. – GL. Markt 4
[1885]
Kämpfer, Isac [!], Pfandleih-Anst.,
Wasserstr. 12 pt.
Kämpfer, Paul, Kaufmann, Wasserstr. 13 I.
Kämpfer, Jacob, Weißwarengeschäft, GL. Alter Markt 1
Seitenhaus pt., w. Alter Markt 86 II.
Kämpfer, Louis, Kaufmann, GL.
Alter Markt 91 pt., w. Alter Markt 92 I.
1885 existiert die Cohnsche Wohnung in der Breslauer Straße 35 (2.
Etage) nicht mehr und, obwohl er laut GPK erst 1902 in Posen aus dem
Leben schied, verschwindet Cohn nun endgültig aus dem Adressbuch der
Stadt. Möglich ist, dass eine schwere Krankheit seiner schon 1886
ebenfalls in Posen gestorbenen Frau Emilie einen Umzug nötig gemacht
hat. Aber wohin? Vielleicht zurück nach Wreschen? – Seit 1879 war neben
Louis auch Jacob, höchstwahrscheinlich ein weiterer Sohn, in der
Cohnschen Wohnung als Kaufmann gemeldet. Beide wohnten und betrieben
ihre Geschäfte spätestens ab 1884/5 am Posener Markt, der nun „Alter
Markt“ genannt wird. – Wichtig sind ebenfalls die Kaempferschen Umzüge
in der Wasserstraße (Nr. 12, 13 und 14): Zwischen 1872 und 79 war Isaak
(1879 fälschlich „Jacob“) in der Nr. 13 gemeldet, wo er im Parterre mit
„Kurzwaren“ (Accessoires für Näh- und Schneiderarbeiten) handelte und im
1. Stock seine Wohnung hatte. Spätestens ab 1884/5 zog er dann in die
Nr. 12, wo er nun im Erdgeschoss als Pfandleiher seinen Unterhalt
verdiente und auch noch 1917 dort als „Hausbesitzer“ gemeldet war. Es
könnte gut sein, dass eine Heirat und die Geburt seines mutmaßlichen
Sohnes Georg ihn am 29. 12. 1883 zu diesem Umzug veranlasst hat.
Interessant ist dabei auch, dass nun Paul Isaaks ehemalige Wohnung im 1.
Stock der Nr. 13 bezogen hat. Warum hat er sich dort einquartiert? In
welcher verwandtschaftlichen Beziehung standen die beiden Familienväter
zueinander? Unter diesen Umständen ist es höchst unwahrscheinlich, dass
sie nur einfache Namensvetter gewesen sind. Aber zurück zu den
Adressbüchern:
[1886]
Kaempfer, Jacob, Wäschehandlung, [w.] Bismarckstr. 7,
GL. Alter Markt 1
Kaempfer, Isaak, Pfandleih-Anstalt, Wasserstr. 12
Kaempfer, Paul, Getreide- und
Kommissions-Geschäft, Wasserstr. 13 I.
Kaempfer, Louis, Weißwarenhandlung, Alter Markt 98/96 I.
[1891]
Kämpfer [sic], Jacob, Wäsche-Fabrik u. Leinen-Lager, [w.]
Alt. Markt 88 II. GL.< Alt. Markt 4
Kaempfer, Isaak, Pfandleih-Anstalt, Wasserstr. 12 I.
Kaempfer, Paul, Kommissionär, Sapiehaplatz 3 II.
Kaempfer, Louis, Weißwaren-Handlung, [w.] St.-Martinstr. 26
pt. GL. Alt. Markt 44
[1894]
Kaempfer, Isaak, Pfandleih-Anstalt, Eigenth.,Wasserstr. 12 I.
Kaempfer, Saul [!], Getreide-Kommissions-Geschäft, Sapiehaplatz 3
II.
Kaempfer, Louis, Kaufmann u. Eigentümer, St.-Martinstr. 33 I.
[1899]
Kaempfer, Isaak, Pfandleihanstalt, Wasserstr. 12 I.
Kaempfer, Paul, Kaufmann, Wronkerplatz 3 I.
Kaempfer, Felix, Dr., Rechtsanwalt, Kanonenplatz 8 II.
Bureau: Friedrichstr. 33
Neben „Cohn-John“ gibt es also auch noch eine „Paul-Saul-Variation“, da
wir davon ausgehen können, dass es sich bei „Saul“ um den in der 1894er
Ausgabe ausnahmsweise fehlenden Paul handelt. – Zu bemerken ist auch das
Verschwinden der beiden mutmaßlichen Cohn-Söhne Jacob (1891/94) und
Louis (1894/99) aus den Posener Verzeichnissen. Letzteren meine ich dann
in den Berliner Adressbüchern (BAB)
(9) aufgespürt zu haben. Und Jacob könnte in der Tat nach Amerika
ausgewandert sein.
1891 hat Paul die Wasserstraße verlassen, um sich
zuerst am Sapiehaplatz („Saul“) und angrenzenden Wronkerplatz
niederzulassen. Von 1901 bis 1917 wohnt er dann in der St.
Adalbertsstraße 31 II. vielleicht sogar bis zu seinem Tod, am 10.
Mai 1919. Sein Sohn Felix wechselt mehrmals die Privatadresse, seine
Kanzlei befindet sich jedoch bis 1917 in der Friedrichstraße. Bald
darauf, ob nun nach Ableben des Vaters oder in den Wirren der Polnischen
Freiheitskämpfe nach dem Ersten Weltkrieg, zieht er, wie sein Enkel
Raymond berichtet, mit seiner Familie und dem Sohn Heinz nach Berlin, wo
er schon am 4. Dezember 1920 stirbt.
Hier noch die Kaempfers in den PAB der Jahre 1901-1917:
Eine
Ottilie Kaempfer war um 1900 in der Pankower Allee 40,
Berlin-Reinickendorf als Näherin gemeldet (siehe
BAB 1899). Es ist gut möglich, dass es sich um dieselbe Person
handelt, die 1910 (wieder?) in Posen wohnte. Zu „Generalleutnant“
Max,
der wohl im Zuge des 1. Weltkriegs nach Posen gekommen oder
zurückgekehrt ist, habe ich keine Informationen.
______________________________
Posen, Alter Markt, wahrscheinlich zu Anfang des 20. Jahrhunderts
(Himmel von mir ersetzt)
(1) Unter folgender Adresse abrufbar:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=addressbuch